„A whole new world…“? – Wohl eher nicht. Unsere Autorin findet, die Realverfilmung des Disney-Klassikers „Aladdin“ verbessert nur wenige der orientalistischen Stereotypen des Zeichentrickfilms.
Am 23. Mai 2019 kam die lang erwartete Neuverfilmung von „Aladdin“ in die Kinos. Die Erwartungen an den britischen Regisseur Guy Ritchie waren hoch. Schon im Vorfeld standen die Umsetzung und das Vorhaben der Neuverfilmung in Sozialen Medien stark in der Kritik und die Aufforderung, alte Klischees und Stereotypen aus dem Zeichentrickfilm zu verbessern, war in aller Munde.
Die Geschichte des jungen Taschendiebs Aladdin spielt in der fiktionalen Stadt Agrabah, die von vermeintlich nahöstlichen Städten inspiriert ist. Aladdin verliebt sich in die Prinzessin Jasmin und versucht sie mit Hilfe des Flaschengeistes Dschinni für sich zu gewinnen.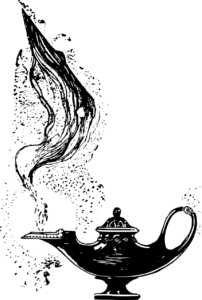
Doch der Bösewicht der Geschichte, Jafar – der Wesir (Minister) des Sultans, hat es auf die magische Flasche abgesehen, mit deren Hilfe er zum mächtigsten Mann der Welt werden will. Klingt eigentlich nach einem harmlosen Märchen für Kinder, gäbe es nicht zahlreiche Klischees, mit denen Disney ein verzerrtes Bild des „Orients“ zeichnet und zum westlichen Orientalismus beiträgt.
Orientalismus nach Edward Said
1979 prägte der Literaturprofessor Edward Said den Begriff Orientalismus in seinem gleichnamigen Buch. Said definiert Orientalismus als eine Denkart, die auf der Unterscheidung zwischen dem „Orient“ und dem „Okzident“ basiert. Orientalismus ist eine politische Vision der Realität, die die Differenz zwischen dem Bekannten – Europa/Nordamerika, der Westen – und dem Fremden – der „Orient“, der Osten – verstärkt.
Dabei beruht die Beziehung zwischen dem „Okzident“ und dem „Orient“ auf Macht, Dominanz und Hegemonie, wobei der Westen in jeglicher Hinsicht – sei es politisch, kulturell oder religiös – der vermeintlich stärkere Partner ist. Orientalismus wird dadurch zu einem System, das durch Theorien und Praktiken, die über Generationen weiterverwendet wurden, am Laufen gehalten wird und durch die stetige Reproduktion im westlichen Bewusstsein als anerkannt und wahr gilt.
Diese Reproduktion erfolgt unter anderem auch durch westliche Filmproduktionen, die immer wieder orientalische Stereotypen bedienen. Said betonte mehrmals, dass das Wissen vom „Orient“, welches durch vermeintliche westliche Stärke generiert wurde, den „Orient“ und das „Orientalische“ erst erschuf. Dadurch existiert der „Orient“ nur in einem bestimmten von außen dominierten Rahmen.
Er wurde nicht nur als unterlegen dargestellt, sondern auch als der westlichen Korrektur bedürftig. Es ist kein Zufall, dass die Blütezeit des Orientalismus mit der Periode des europäischen Kolonialismus, den die orientalistischen Narrative rechtfertigten, zusammenfiel.
Im Sinne einer intellektuellen Macht kann Orientalismus nach Said als ein Archiv von Informationen gesehen werden, welche das Verhalten, die Mentalität und Genealogie der „Orientalen“ erklären und den Europäer*innen im Zuge der Kolonialisierung der Region helfen sollte, damit umzugehen. Als solches beinhaltet Orientalismus allerdings auch eine Vielzahl von Generalisierungen und nur limitiertes Wissen über den „Orient“.
Orientalismus im Zeichentrickfilm
Doch was hat das alles mit dem süßen und „harmlosen“ Disney-Zeichentrickfilm „Aladdin“ von 1992 zu tun? Leider eine ganze Menge.
Disney erschafft das Bild einer vermeintlich nahöstlichen Stadt, wie sie in den Augen westlicher Betrachter*innen auszusehen hat. Agrabah ist zwar fiktional, dennoch erinnern zahlreiche Elemente der Stadt unweigerlich an real existierende Orte.
Da ist das bunte Treiben auf dem Markt in der Stadt, auf dem verschiedene Verkäufer*innen ihre Ware bewerben und um den Preis gefeilscht wird. Diese Szenen könnten problemlos auf einem Souq (Arabisch für Markt) in Nordafrika oder auf der Arabischen Halbinsel spielen.
Dann wiederum erscheint der große Palast von Agrabah auf dem Bildschirm, der mit seinen Zwiebeltürmen und zahlreichen Kuppeln vom indischen Taj Mahal inspiriert zu sein scheint. Disney wirft damit zahlreiche unterschiedliche Kulturen und Baustile in einen Topf, ohne diese auch nur ansatzweise zu differenzieren. Es scheint als wolle Disney damit sagen: Ob jetzt marokkanisch, libanesisch oder indisch – ist doch eh alles das Gleiche!
Dieses orientalistische Bild wird in einem weiteren Schritt noch verstärkt. Durch die Lyrics der Filmmusik (für die Disney übrigens einen Academy Award erhielt), wird Agrabah als eine fremde, weit entfernte Stadt geschildert. Eine ganz neue Welt, die so anders von der Westlichen ist.
Im Eröffnungssong „Arabian Nights“ wurde wortwörtlich gesungen: „I come from a land from a far-away place/Where they cut off your ear if they don’t like your face/It’s barbaric, but hey, it’s home.” Zeilen wie diese verstärken die orientalistische Annahme, dass der „Orient“ unterentwickelt und barbarisch ist.
Erst nachdem der Schriftsteller und Professor Jack G. Shaheen gemeinsam mit dem „American Arab Anti-Discrimination Committee“ eine Kampagne gegen die Lyrics startete, strich Disney diese Sätze mit Ausnahme des letzten Satzes „It’s barbaric, but hey, it’s home“ bei der zu verkaufenden Videokassette.
Und auch bei den Protagonist*innen wendet Disney eine Taktik an, die bereits bei anderen Disney-Filmen, wie zum Beispiel Pocahontas, zu beobachten war. Disney stellt die beiden Protagonist*innen, Aladdin und Jasmin, als Ausnahme von ihrer eigenen Kultur dar.
Dies zeigt sich sowohl durch ihr Äußerliches als auch durch ihr Verhalten. Aladdin und Jasmin haben beispielsweise einen helleren Hautton als der böse Jafar. Jafar wird mit dunklem Bart und Haut und einer krummen Nase gezeichnet und verkörpert den Klischee-Araber, der hinterhältig und skrupellos ist und dem die Meinung einer Frau egal ist.
Jasmin hingegen will aus ihrem Alltag ausbrechen. Sie wehrt sich, vermeintlich untypisch für ihre eigene Kultur, gegen die Bevormundung von Frauen und möchte Nachfolgerin ihres Vaters werden, was die Tradition allerdings nicht zu lässt.
Und Aladdins persönliche Geschichte entspricht eins zu eins der typisch westlichen Erfolgsgeschichte vom Tellerwäscher zum Millionär – nur eben vom Straßendieb zum Prinzen. Er ist anders als die Anderen. Er wünscht sich von Dschinni nur seiner geliebten Jasmin nah sein zu dürfen, anstatt Ruhm, Reichtum und Macht, wie es alle Gebieter*innen vor ihm taten.
 Auf seinem Weg muss er Rückschläge hinnehmen, doch er gibt nicht auf und verliert nie die Hoffnung. Der Dschinni begleitet ihn, hilft ihm und lockert nebenbei immer wieder die Stimmung auf mit Witzen, die eindeutig aus der amerikanischen Popkultur stammen. In einem Kommentar zum Film schrieb Aja Romano in dem Online-Magazin Vox sehr treffend: „In essence, it’s very easy to unthinkingly read Aladdin and the Dschinni as two Yankees in a land full of exotic Others.”
Auf seinem Weg muss er Rückschläge hinnehmen, doch er gibt nicht auf und verliert nie die Hoffnung. Der Dschinni begleitet ihn, hilft ihm und lockert nebenbei immer wieder die Stimmung auf mit Witzen, die eindeutig aus der amerikanischen Popkultur stammen. In einem Kommentar zum Film schrieb Aja Romano in dem Online-Magazin Vox sehr treffend: „In essence, it’s very easy to unthinkingly read Aladdin and the Dschinni as two Yankees in a land full of exotic Others.”
Jasmin und Aladdin sind also die Ausnahmen ihrer eigenen Gesellschaft. Sie stellen sich gegen die Tradition und versuchen aus ihrer eigenen Kultur auszubrechen. Damit verkörpern sie die westlichen Held*innen der Geschichte. Demgegenüber steht Jafar, der böse Gegenspieler, der alle negativen Klischees und Stereotypen erfüllt, die sich der Westen jemals für die arabische Welt hat einfallen lassen.
Noch deutlicher wird dies in der englischen Originalversion, in der Jafar mit arabischem, Jasmin und Aladdin hingegen mit amerikanischem Akzent sprechen. Dazu kommt das Setting, in einer Stadt, die reale Kulturen vermischt, und mit Musik, die mit ihren Lyrics den Graben zwischen „Okzident“ und „Orient“ und die Überlegenheit des Westens nur noch mehr verstärkt. Alles in allem ist der Zeichentrickfilm ein Paradebeispiel für westlichen Orientalismus.
Orientalismus in der Realverfilmung
Guy Ritchie hätte theoretisch also einiges an Verbesserungen zu erledigen gehabt. Davon ist allerdings nicht viel angekommen. Die Realverfilmung ist meiner Meinung nach gefangen zwischen „Wir wollen so nah wie möglich am Original bleiben“ und „Wir versuchen die Stereotypen auszubessern“. Letzteres ist dabei größtenteils auf der Strecke geblieben und tatsächlich sind sogar neue Problematiken hinzugekommen.
Der Schauplatz bleibt der Gleiche: Agrabah. Wieder mischen sich arabischer Souq und indischer Taj Mahal. Hinzukommen viele Kleinigkeiten, die den Eindruck der Vermischung der Kulturen noch verstärken.
Zum einen werden zusätzlich verschiedene Kleidungsstile gemischt. Von indischen Saris, über Kopftücher, Turbane und Tarbusche (rote Kopfbedeckungen, die für das Osmanische Reich typisch waren) ist alles dabei. Zum anderen sieht man immer wieder arabische Schrift und im Hintergrund werden arabische und persische Sätze gemurmelt.
Kulturelle Sensibilität und Differenzierung? Fehlanzeige. Auch musikalisch mischt sich Bauchtanz mit typischen Bollywood-Tanzeinlagen. Immerhin wurden die Lyrics ausgetauscht. Die oben genannten kritischen Sätze wurden ersetzt durch: „ Oh, imagine a land, it’s a faraway place/Where the caravan camels roam/Where you wander among every culture and tongue/It’s chaotic, but hey, it’s home.”
Dafür führte bereits der Cast für die Hauptrollen zu Kontroversen und Diskussionen. Disney schien sich schwer zu tun, Schauspieler*innen zu finden, die nahöstlichen Hintergrund haben und dazu noch tanzen und singen können, weshalb der Cast ungewöhnlich lange dauerte.
BBC zitierte dazu den Kommentar der deutsch-palästinensischen Regisseurin Lexi Alexander: „Nobody in their right mind can state that it is impossible to find a young male South Asian or Middle-Eastern actor who can dance, sing and act […] Bollywood is an entire industry made up of talents like this and the Middle East has equally as much talent. It’s a convenient system that insists actors-of-colour need to be household names to be cast, while nobody wants to give them a break.”
Aus meiner Sicht könnte das lange Suchen von Seiten Disneys noch einen anderen Grund gehabt haben. Schaut man sich den Cast an, der letztendlich die Hauptrollen besetzte, ist es meines Erachtens extrem auffällig, dass jede*r Schauspieler*in nicht nur einen nahöstlichen, sondern auch einen westlichen Hintergrund hat.
Mena Massoud (Aladdin) hat ägyptisch-kanadische Wurzeln, Naomi Scott (Jasmin) ist indisch-britisch, Marwan Kenzari (Jafar) tunesisch-niederländisch und Navid Negahban (Sultan) iranisch-amerikanisch. Versteht mich nicht falsch, die Schauspieler*innen leisten einen großartigen Job und schaffen es, das Publikum hervorragend mitzureißen. Vor allem Mena Massoud schaffte es im Nahen Osten zum Publikumsliebling.
Dennoch scheint es, als wolle Disney um jeden Preis ein Stück westlicher Kultur in den Film einfließen lassen und verzichtet daher lieber auf Schauspieler*innen, die ausschließlich aus der Region stammen. Da kann die Suche nach den perfekten „halb-halb“ Schauspieler*innen schon mal länger dauern.
Versüßt wird dieser ohnehin schon halb westliche-halb nahöstliche Cast mit einer Prise erstklassischem Hollywood-Oldie, Will Smith (Dschinni). Dessen Wahl zum Dschinni birgt eine weitere Kontroverse, denn die Rolle des Dschinni ist wohl die einzige im ganzen Film, die ausnahmsweise besser nicht mit einem Man of Colour hätte besetzt werden sollen.
Regelmäßig tritt in amerikanischen Filmen und Büchern die Figur eines sogenannten „Magical Negro“ auf. Dies ist ein Character of Colour, dessen Aufgabe einzig und allein darin besteht, dem/der weißen Protagonist*in zur Seite zu stehen. Der „Magical Negro“ hat oftmals spezielle oder magische Fähigkeiten, mit denen er der weißen Hauptrolle hilft, dessen Ziele zu erreichen.
Der Filmemacher Spike Lee kritisierte 2001 die Rolle des „Magical Negro“ als eine abgemilderte Form des „Happy Slave“-Stereotypens. Durch die Besetzung der Rolle des Dschinni mit einem Man of Colour bedient Disney also auch noch den kritischen Topos des „Magical Negro“.
Alles in allem lässt sich feststellen, dass Disney die Erwartungen mit der Realverfilmung von „Aladdin“ nicht erfüllt hat. Zugegebenermaßen ist es aber auch verdammt schwierig, einen Film zu produzieren, der frei von Stereotypen und Klischees sein soll, wenn das Original, auf dem jener Film basiert, nur so davon strotzt. Abschließend möchte ich die Professorin Evelyn Alsultany zitieren, die sehr deutlich erklärt, was das Problem mit Filmen wie diesen ist:
„‘Aladdin,‘ of course, is a fantastical tale, so questions about representational accuracy might seem overblown. It is also a really fun movie in which Mena Massoud, Naomi Scott and Will Smith all shine in their roles. But over the last century, Hollywood has produced over 900 films that stereotype Arabs and Muslims – a relentless drumbeat of stereotypes that influences public opinion and policies. If there were 900 films that didn’t portray Arabs, Iranians and Muslims as terrorists or revert to old Orientalist tropes, then films like ‘Aladdin’ could be ‘just entertainment’”.
Von Sabrina Ahmed
